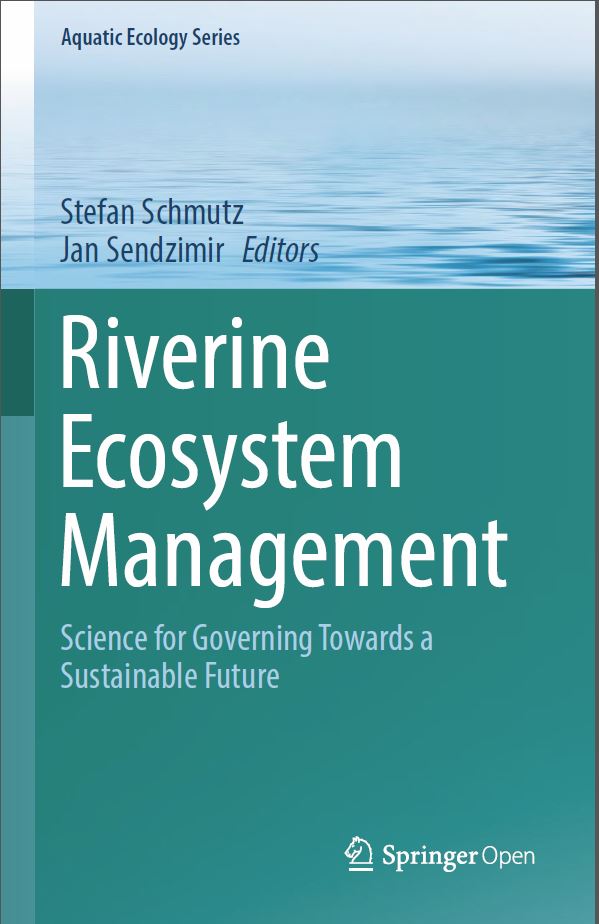In Kooperation mit SLU Uppsala und der chinesischen Akademie der Wissenschaften wurde am WasserCluster Lunz der Effekt von Klimawandel auf die Bioakkumulation von Methylquecksilber an der Basis der aquatischen Nahrungskette in Freiland-Mesokosmen untersucht. Dabei wurden die Wassertemperaturen und die Zufuhr von gelöst organischem Kohlenstoff erhöht.
(Foto: Fernando Valdés, Pianpian Wu, Kevin Bishop, Siwen Zheng, Min Jing, Julia Mercier, Agathe Clermont, Martin Kainz)
Am Mittwoch, den 19. September 2018, zeichnete Bundesminister Univ.-Prof. Heinz Faßmann (BMBWF) im Rahmen einer Festveranstaltung in Wien 20 Schulen mit dem Young Science-Gütesiegel für Forschungspartnerschulen aus. Die NMS Lunz erhielt den Preis für ihre hervorragende Arbeiten der naturwissenschaftlichen Projektgruppe und die regelmäßige Zusammenarbeit mit dem WasserCluster Lunz in den Projekten Wasser:KRAFT und Wasser schafft.
Wir gratulieren herzlich!
(Foto: OeAD/APA-Fotoservice/Schedl)
Mit August 2018 wird unter der Leitung von Simon Vitecek eine neue Arbeitsgruppe zur Diversität aquatischer Insekten und aquatischer Entomologie beginnen. Diese fünfte Arbeitsgruppe namens „QUIVER“ wird sich mit regionalen und globalen Mustern von Insektenbiodiversität unter Verwendung klassisch taxonomischer und molekularer Methoden befassen.
Mehr über die Arbeitsgruppe QUIVER
Foto: Steinfliege der Gattung Perla sp. beim Fouragieren (Copyright: Simon Vitecek)
Wie wirkt sich Austrocknung auf die Selbstreinigungsleistung von Bächen aus?
Im Projekt PURIFY untersuchen wir, wie stark sich Austrocknung auf die Selbstreinigungskraft von Bächen in Kärnten, im Burgenland und in der Steiermark auswirkt und welche Rolle dabei die Beschaffenheit der Bachsedimente spielen.
Mehr zum Projekt findet ihr unter: http://www.wcl.ac.at/index.php/en/research/projects
(Foto: Ausgetrocknetes Flussbett des Glauningbachs, made by Oliver Zweidick)
Im April fand in Lunz der zweite sTurn Workshop statt. Im Rahmen des Workshops beschäftigten sich ein Team von 12 internationalen Wissenschaftlern unter der Leitung von Z. Horvath und R. Ptacnik vom WasserCluster Lunz intensiv mit der Biodiversitätsforschung. Um ein ganzheitlicheres Verständnis zu erlangen, werden Prozesse in Zeit und Raum parallel untersucht und Modellierung mit der Analyse von empirischen Daten kombiniert. Darüberhinaus wurden die jüngsten Fortschritte in der "Metacommunity"-Forschung bei einem Seminar am WasserCluster Lunz präsentiert.
Das im Mai 2018 veröffentlichte Buch "Riverine Ecosystem Management - Science for Governing Towards a Sustainable Future", an dem einige Forscher und Forscherinnen des WasserClusters mitgewirkt haben, ist nun unter https://rd.springer.com/book/10.1007/978-3-319-73250-3 kostenfrei verfügbar.
Erfahren Sie mehr über best-practice Beispiele für nachhaltiges Flussmanagement und identifizieren Sie aktuelle Probleme bzw. Lösungsansätze.
Viel Spaß beim Lesen!
Am 13. April 2018 war es wieder soweit. Die Lange Nacht der Forschung fand an über 260 Standorten statt. Auch der WasserCluster Lunz bot mit Infopoints zu den Themen "Die Welt des Planktons - was lebt im Wassertropfen?" und "Was fressen Bakterien in Bächen am liebsten?" einen Einblick in die Welt der Forschung.
Fotos vom Event finden Sie hier.
vom Montag (26.3.2018) bis Freitag (30.3.2018), jeweils 8:55 bis 9:00, gibt es die Möglichkeit den Ausführungen von Thomas Hein zum Thema „Schwebende Organismen im Wasser“ in der Ö1 Sendung „Vom Leben der Natur“ zu lauschen.
Teil 1: Abhängig von Strömungen
Teil 2: Von Mikro bis Mega
Teil 3: Vielgestaltig in Form und Farbe
Teil 4: Fressen oder gefressen werden?
Teil 5: Der Fluss als Lebensraum
Mehr Informationen: http://oe1.orf.at/vomlebendernatur